Solar TAP
Umweltfreundlich, flexiblen Solarzellen aus dem Drucker stehen auch im Fokus der Innovationsplattform Solar TAP, die Christoph Brabec mit koordiniert.
Aufrollbare Displays und Photovoltaikfolien für Fassaden – die organische Elektronik bietet viel Potenzial. Doch bevor die neue Technik zum Massenprodukt wird, sollten Recyclingkonzepte vorliegen, empfiehlt Materialforscher Christoph Brabec.
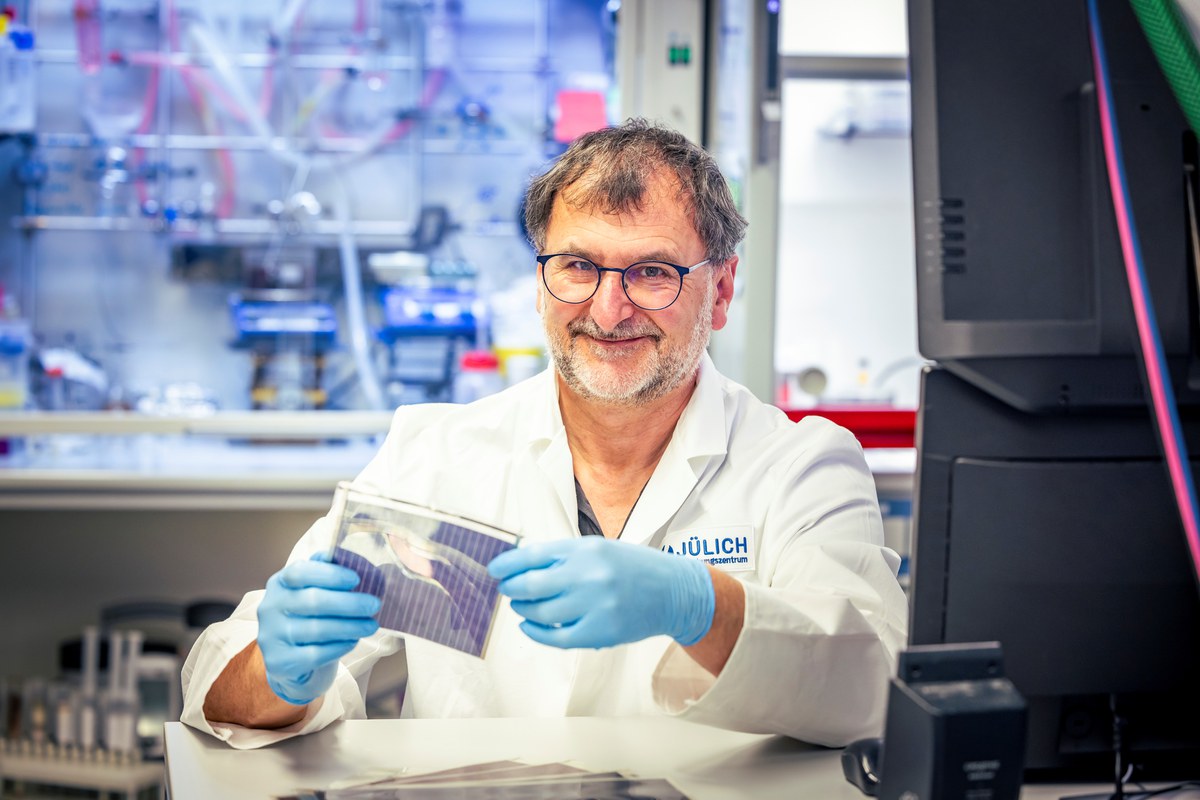
Herr Brabec, Sie haben gemeinsam mit Kolleg:innen aus Deutschland, Großbritannien und den USA in einer Publikation dafür geworben, organische Elektronik nachhaltig zu entwickeln. Was steckt dahinter?
Diese Technik kommt in immer mehr Produkten zum Einsatz. Displays sind aktuell der größte Markt; man kennt vielleicht die Bezeichnungen AMOLED oder OLED bei Fernseher oder Smartphone. Und in den nächsten Jahren werden noch weitere Anwendungen hinzukommen. Damit wir in Zukunft nicht unnötig Elektromüll produzieren, müssen wir schon heute nachhaltige Lösungen für organische Elektronik entwerfen – also nicht nur Herstellungsverfahren und Eigenschaften weiterentwickeln, sondern bereits im Labor technische Lösungen für das Recycling planen. In 20 Jahren, wenn sich möglicherweise ein Massenmarkt dafür entwickelt hat, ist es zu spät.
Was fällt überhaupt unter organische Elektronik?
Das ist ein Sammelbegriff für elektronische Schaltungen, die aus organischen Polymeren oder kleineren organischen Molekülen bestehen. In erster Linie geht es dabei um Halbleiter, das sind die zentralen Bausteine aller digitalen Geräte. Die herkömmlichen Varianten basieren großteils auf Silizium, die organischen dagegen hauptsächlich auf Kohlenstoff. Es gibt reine Kohlenstoffhalbleiter wie zum Beispiel Diamant, Fulleren oder Graphen. Die üblichen sind aber Heterosysteme, da sind dann Elemente wie Schwefel, Fluor oder Stickstoff mit drin.
Worin unterscheiden sich Halbleiter aus Silizium und Kohlenstoff?
Kohlenstoffbasierte Verbindungen sind so wie Silizium im Überfluss vorhanden. Im Unterschied zu Silizium, das als Einkristall gezüchtet wird, werden die organischen Verbindungen chemisch synthetisiert. Das Verfahren zum Herstellen von organischer Elektronik verbraucht außerdem vergleichsweise wenig Energie und ist besonders gut geeignet, um dünne elektronische Schichten auf großformatige Substrate aufzubringen. Auf diese Weise kann man auch flexible Polymerfolien herstellen, etwa faltbare oder aufrollbare Displays, was mit Silizium deutlich schwieriger ist. Außerdem lassen sich organische Halbleiter digital drucken, also mittels Tintenstrahldrucktechnik auftragen; die Patrone ist dann mit organischen Molekülen gefüllt. Es werden schon Displays für Laptops auf diese recht schnelle Art produziert. Auch für die Photovoltaik bietet organische Elektronik nützliche Eigenschaften.

Damit wir in Zukunft nicht unnötig Elektromüll produzieren, müssen wir schon heute nachhaltige Lösungen für organische Elektronik entwerfen – also nicht nur Herstellungsverfahren und Eigenschaften weiterentwickeln, sondern bereits im Labor technische Lösungen für das Recycling planen. In 20 Jahren, wenn sich möglicherweise ein Massenmarkt dafür entwickelt hat, ist es zu spät.
Die da wären?
Organische Halbleiter kann man sehr einfach transparent gestalten. Sie absorbieren dann das infrarote Licht, also die Wärmestrahlung, aber nicht das sichtbare Licht. Um klassische Siliziumhalbleiter durchsichtig zu machen, müssen sie sehr dünn sein, was die Leistung reduziert. Transparente organische Halbleiter können daher theoretisch eine sehr hohe Leistungseffizienz erreichen. Im Allgemeinen hat Silizium zwar mit bis zu 27 Prozent den deutlich höheren Wirkungsgrad, doch durch die gezielten Entwicklungen der Materialeigenschaften der letzten Jahre hat die organische Photovoltaik im Labor bereits 20 Prozent Wirkungsgrad erreicht. Für bestimmte Flächen und Anwendungen könnte die organische Photovoltaik sogar deutlich geeigneter als traditionelle PV-Systeme sein.
Für welche?
Zum Beispiel Fassaden, Fenster oder landwirtschaftlich genutzte Flächen, wo sich die großflächige Stromerzeugung durch eine Integration der organische Photovoltaikanlagen realisieren lässt. Es gibt erste Projekte, wo dies bereits umgesetzt wurde. Ein weiterer Markt, der sich abzeichnet, sind Module für die Leistungsversorgung von IoT-Anwendungen – also Geräte, die mit dem Internet of Things zu tun haben. Da geht es um kleine elektronische Gadgets und Sensoren, die man ohne Batterien betreiben will.
Und wie sieht es mit der Umweltbilanz aus?
Wenn man die gesamte Wertschöpfungskette betrachtet, wird bei organischen Solarzellen zwei bis drei Mal weniger CO2 frei als bei siliziumbasierten und das kann noch besser werden. Das liegt zum Beispiel daran, dass die Herstellung wenig Energie verbraucht. Außerdem ist der Durchsatz der Drucktechnologie sehr hoch, was auch Energie spart. Und das Gewicht der Folien ist sehr gering. Das macht die Technik sehr attraktiv für Transport und Montage. Man bekommt am Ende deutlich mehr Watt pro Gramm.
Aber noch ist organische Elektronik relativ teuer?
Ja, das liegt daran, dass es Millionen unterschiedliche organische Halbleiter gibt und sich bislang in der Praxis noch keine einzelnen Exemplare durchgesetzt haben. Entsprechend hat sich noch keine Wertschöpfungskette konsolidiert, weshalb die Herstellungskosten sehr hoch sind. Aber wir gehen davon aus, dass sich das ändern wird. Und an der Stelle ist es wichtig, sich bereits heute Gedanken zu machen, wie Bauteile aus organischer Elektronik über den gesamten Lebenszyklus hinweg einen möglichst geringen ökologischen Fußabdruck hinterlassen.
Was gilt es also zu tun?
Viele heutigen Elektronikbauteile sind so konzipiert, dass sie sich nicht wieder auseinanderbauen lassen. Die organischen Elektronikbauteile sollten von vornherein so gestaltet werden, dass ein einfaches Recycling möglich ist und dies auch wirtschaftlich Sinn macht. Heißt: Energie- und Kostenaufwand der Wiederverwertung dürfen nicht höher sein als die der Produktion. Diese Aspekte müssen wir bereits in der Entwicklung berücksichtigen. Das Ziel wäre eine Kreislaufwirtschaft.
Eigenschaften maßschneidern
Herkömmliche Halbleiter haben eine geordnete kristalline oder polykristalline Struktur, die organischen Varianten sind hingegen ungeordnet. Das liegt am Herstellungsprozess, in dem die organischen Polymere zunächst in Lösung vorliegen. Beim Verdampfen auf einer Oberfläche arrangieren sich die Moleküle in einem unregelmäßigen Muster, Fachleute sprechen auch von einem amorphen Mikrogefüge. Doch auch hier bilden sich gewisse wiederkehrende Bereiche mit geordneten Strukturen, so genannte Domänen. Je nach Größe und Ausprägung dieser Domänen können die organischen Halbleiterstrukturen dann vollkommen unterschiedliche Eigenschaften haben. Jülicher Wissenschaftler:innen erforschen mit Unterstützung der KI den Einfluss der Produktion auf das Endergebnis und versuchen, so bestimmte Eigenschaften maßzuschneidern.
Und wie geht das?
Unter anderem mit sogenannten Multilayer-Designs. Dabei bestehen Bauteile als leicht voneinander trennbaren Schichten. So kann man schon bei der Konstruktion dafür sorgen, dass sich verschiedene Materialien am Ende ihres Produktlebens gut recyceln lassen. Dafür sind organische Halbleiter sehr gut geeignet, weil man sie im Vergleich zu siliziumbasierten Halbleitern einfach wieder auflösen kann. Aber wir sollten beispielsweise auch Substrate verwenden, die sich entweder gut wiederverwenden lassen oder aber ebenfalls leicht abbaubar sind. Daneben muss man auch sicherstellen, bei der Produktion keine toxischen Stoffe zu verwenden.
Was tragen Sie mit Ihrer Forschung dazu bei?
An unserem Institut beschäftigen wir uns mit Herstellungsprozessen von organischer Elektronik. Einerseits untersuchen wir den Einfluss der Produktion auf das Endergebnis – also einen fertigen organischen Halbleiter – und andererseits versuchen wir, den Prozess so zu optimieren, dass der Halbleiter die bestmögliche Performance liefert. Weitere gewünschte Eigenschaften sind außerdem eine lange Haltbarkeit und eben das Recycling.
Wie gehen Sie dazu vor?
Wir bauen Forschungs- und Entwicklungsanlagen, die von künstlichen Intelligenzen gesteuert werden. Wenn man zum Beispiel ein Material haben will, das bestimmte Eigenschaften hat, versucht die KI in Experimenten die »einfachsten« Materialien zu finden, die dafür am besten geeignet sind. Andererseits kann sie auch den Herstellungsprozess so optimieren, dass das Material am Ende die bestmöglichen Eigenschaften hat. Die KI analysiert dazu die Daten aus einem Experiment und entscheidet daraufhin, welche weiteren Versuche durchgeführt werden müssen, und so geht es weiter, bis ein Optimum erreicht wird – zum Beispiel bei organischen Solarzellen, die leistungsstark sind, lange halten und sich gut recyclen lassen. So wollen wir dazu beitragen, dass die erneuerbaren Energien in Zukunft noch nachhaltiger und deutlich attraktiver werden.
Zur Person
Prof. Christoph Brabec ist Direktor des Helmholtz-Instituts Erlangen-Nürnberg für Erneuerbare Energien (IET-2), einer Außenstelle des Forschungszentrums Jülich. Am IET-2 leitet er die Forschungsabteilung „Hochdurchsatzverfahren in der Photovoltaik“. Gleichzeitig hat er an der Friedrich -Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg den Lehrstuhl für Werkstoffwissenschaften (Materialien der Elektronik und der Energietechnologie) inne. Der Materialforscher taucht regelmäßig in der Liste der weltweit am häufigsten zitierten Wissenschaftler:innen auf.
Das Interview führte Janosch Deeg, Bilder Martin Leclaire Photographie und @EnCN.