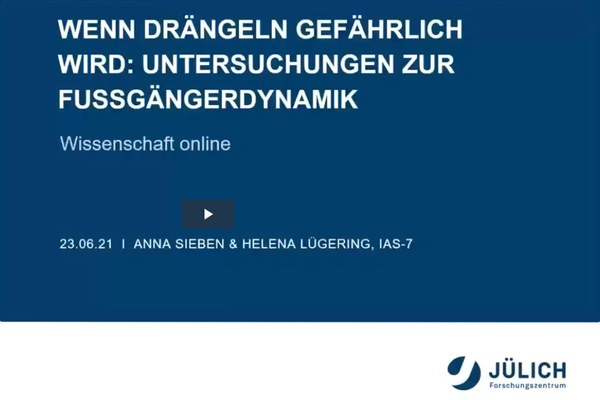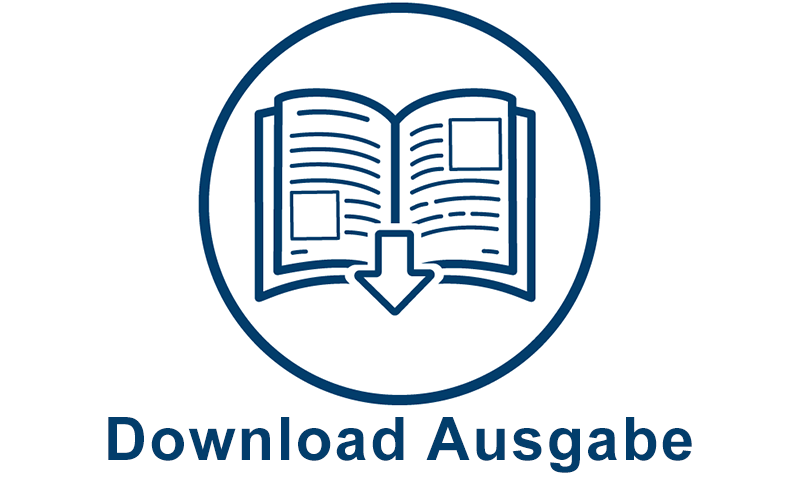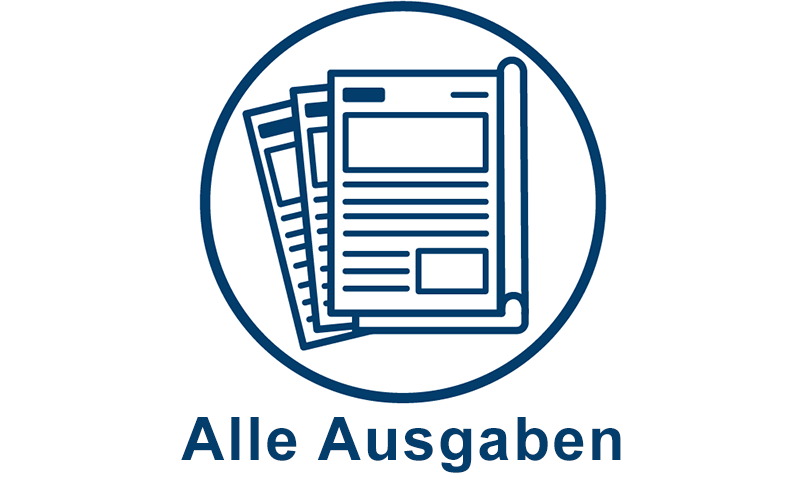Voll ausgestattet und startbereit: Reporter Arndt Reuning
Ein sonniger, kühler Herbstmorgen im Düsseldorfer Volksgarten. Vielleicht einer der letzten freundlichen Tage in diesem Jahr. Und ich? Habe nichts Besseres zu tun, als ihn in einer fensterlosen Siebzigerjahre-Halle zu verbringen, zusammengedrängt mit einem Haufen von Fremden. Als Reporter für das effzett-Magazin nehme ich an dem CroMa-Großversuch teil.
Noch weiß ich nicht genau, was mich erwartet. Auf der Website des Projekts heißt es, zu rechnen sei mit „großer Menschenmenge mit zeitweise hohen Dichten und Drücken“. Enger körperlicher Kontakt ist mir eher unangenehm. Ich meide Ansammlungen von Menschen, so gut es eben geht. Gerade in der Pandemie. Daher habe ich ein mulmiges Gefühl im Magen, als ich Richtung Mitsubishi Electric Halle gehe.
1.200
Freiwillige
haben Anfang Oktober vier Tage lang für die
Wissenschaft Zugreisende gespielt. Sie warteten, drängelten und liefen mit und
ohne Gepäck herum, um typische Situationen an Bahnhöfen nachzustellen.

Nach einem Schnelltest betrete ich mit FFP2-Maske über Mund und Nase den Eingangsbereich der Halle. Dort geht es dann zu wie am Fließband: Ich erhalte eine Nummer, ein hellblaues Armbändchen und einen laminierten QR-Code. Ich fülle einen Fragebogen aus und werde gemessen: Schulterbreite, Körpergröße, Gewicht. Eine Helferin setzt mir ein grünes Kopftuch auf und klebt den QR-Code obendarauf. Auf die Schultern kommen zwei große Klebepunkte: himmelblau rechts, schweinchenrosa links.
Die erste Station naht. Bis jetzt ist es mir gut gelungen, auf Distanz zu den anderen rund 80 Teilnehmern in meiner Gruppe zu bleiben. Nun geht es darum, einen improvisierten Bahnsteig über ein paar Stufen zu betreten und dort auf einen imaginären Zug zu warten. Das hatte ich mir schlimmer vorgestellt. Zu jeder Zeit bleibt mir genug Platz. Die ganze Prozedur wiederholen wir mehrmals, jedes Mal mit leichten Variationen: mal sind die Gruppen größer, die gleichzeitig am Bahnsteig ankommen, mal lässt der Zug länger auf sich warten.

Armin Seyfried
„Bahnhöfe in Deutschland sind nicht für die steigenden Fahrgastzahlen ausgelegt, mit denen wir in Zukunft rechnen. In besonderen Situationen könnten dann außergewöhnliche Spitzen auftreten: bei Konzerten, Fußballspielen oder einfach nur bei schlechtem Wetter. Im CroMa-Projekt möchten wir Konzepte entwickeln, wie man schon heute die Bahnhöfe so verändern kann, dass sie einer stärkeren Belastung gewachsen sind. Wir suchen nach Wegen, den vorhandenen Platz optimal zu nutzen, den Komfort für die Fahrgäste zu steigern und, das Wichtigste, die Sicherheit am Bahnsteig zu erhöhen.“
Maik Boltes
„Mit dem CroMa-Experiment haben wir gewaltige Datensätze gesammelt. Kameras unter der Hallendecke konnten über den Code auf den Köpfen der Beteiligten jederzeit deren Position und Laufwege aufzeichnen. Die Bewegungsprofile verknüpfen wir mit anderen Daten. Spezielle Sensoren haben Herzraten und den Hautwiderstand bei ausgewählten Teilnehmern gemessen. Diese Daten verraten uns, ob jemand unter Stress steht. Außerdem haben wir mit speziellen Anzügen die 3D-Bewegung der Teilnehmer aufgezeichnet: Wie setzen sie ihren Körper ein, um sich zum Beispiel ihren Weg in einen Zug oder durch eine Einlassschleuse zu bahnen?“
Anna Sieben
„Viele Menschen betreten den Bahnsteig über die Treppen und bleiben dann um die Aufgänge herum stehen. Auch wenn genug Platz vorhanden ist, wird er oft nicht ausgenutzt. Das kann zum Beispiel an Hindernissen auf dem Bahnsteig liegen. Dann könnte es helfen, die Plattform baulich zu entschlacken oder die Menschen gezielt von den überfüllten Bereichen wegzuleiten. Doch dazu müssen wir zunächst einmal wissen, wie die Menschen sich in unterschiedlichen Situationen auf dem Bahnsteig verhalten.“



Armin Seyfried
„In manchen Situationen verhielten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer rabiater als vermutet, zum Beispiel an den Einlassschleusen. Das löste dann eine durchaus realistische Dynamik aus. Genau das ist der Vorteil des Experimentes gegenüber den Feldstudien: Wir können die Randbedingungen einstellen und die Reaktionen der Menschen darauf beobachten.“
Maik Boltes
„Es war eine Herausforderung, solch ein Experiment mit über 1.200 Personen in Zeiten der Pandemie durchzuführen. Wir mussten es mehrmals verschieben. Das war sehr kräftezehrend. Wir waren ständig im Austausch mit dem Gesundheitsamt und mit dem Krisenstab im Forschungszentrum. Unser Sicherheits- und Hygienekonzept mit Masken und Schnelltests hat dazu beigetragen, dass sich die Teilnehmer sicher fühlen konnten.“
Anna Sieben
„Als Psychologin bin ich überrascht, wie viel Physik hinter diesen Phänomenen steckt. In der Fußgängerforschung können wir Menschen oft einfach als Kugeln betrachten: Wenn es eng wird, müssen sie irgendwie aneinander vorbeikommen – strikt nach den Regeln der Physik. Aber es gibt auch Phänomene, bei denen man sich das individuelle Verhalten anschauen muss: Wie viel Kraft setzt jemand ein, um sich nach vorne zu drängeln? Wie nehmen andere das wahr? Auch soziale Normen beeinflussen das. Physik und Psychologie müssen zusammenkommen, damit man eine realistische Beschreibung der Situation erhält.“
An der zweiten Station sollen wir durch eine von drei Einlassschleusen gehen. Es läuft eher gesittet ab. Schon weit vor der eigentlichen Barriere ordnen wir uns in drei Schlangen an. Beim zweiten Mal sollen wir uns vorstellen, wir seien in Eile. Tatsächlich beginnen manche, zu überholen und sich vorzudrängeln. An den Schleusen kommt es zu einem kleinen Auflauf. Manche Teilnehmer scheinen in ihrer Rolle aufzugehen. Aber ist es überhaupt möglich, in solch einem Experiment das wahre Verhalten von Menschen abzubilden?
An der dritten Station wird es wirklich eng: Dort ist ein improvisiertes Bahnabteil aufgebaut. Wir sollen ein- und aussteigen. In ständig neuen Variationen: mit Rucksack, mit Rollkoffer oder Kinderwagen. Eine Mitarbeiterin gibt Anweisungen: „Der Zug fährt ein. Der Zug hält an. Die Türen öffnen sich.“ Immer und immer wieder. Ich frage mich, wie das Gewimmel für die Kamera über unseren Köpfen aussehen mag. Könnte man unsere Bewegungen beim Ein- und Aussteigen vielleicht sogar rein mit physikalischen Formeln beschreiben?
Sehen Sie hier die Bilder zu dem Projekt:
Etwas, was sich durch den ganzen Tag hindurchzieht: das Ausfüllen von Fragebögen. Habe ich mich eingeengt gefühlt? Habe ich mich unter Körpereinsatz nach vorn gedrängelt? Gab es genug Platz auf der Plattform? Und ganz am Ende nach den Experimenten dann noch ein letztes Formular. Darin geht es um die Pandemiesituation: Habe ich mich sicher gefühlt? Habe ich heute oft an Corona denken müssen?
Später auf dem Heimweg an der S-Bahn-Haltestelle klingt es in meinen Ohren nach: „Der Zug fährt ein. Der Zug hält an. Die Türen öffnen sich.“ Doch im Gegensatz zum Experiment muss ich mich diesmal wirklich extrem eng an anderen Fahrgästen vorbeiquetschen, als die Bahn einfährt. Ich seufze. Vielleicht trägt das CroMa-Projekt ja dazu bei, dass sich bald etwas daran ändert.
Sicher und funktionsfähig
CroMa steht für „Crowd Management in Verkehrsinfrastrukturen“. Durch umfassende Untersuchungen zum Verhalten von Fußgängern in großen Menschenmengen will das Projekt Bahnhöfe optimieren. Gerade in Stoßzeiten sollen diese funktionsfähig und sicher für die Fahrgäste bleiben. Das Projektteam wird dazu Empfehlungen entwickeln, zum Beispiel wie sich die Fußgängerströme durch gezielte Informationen oder Umbauten am Bahnsteig steuern lassen. An dem Projekt beteiligt sind die Bergische Universität Wuppertal als Koordinatorin, das Forschungszentrum Jülich, die Ruhr-Universität Bochum sowie unter anderem Verkehrsunternehmen, Veranstalter, Rettungsdienste, Feuerwehr und die Bundespolizei. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert das Projekt vier Jahre lang mit insgesamt 3,4 Millionen Euro.
Zur Projektwebseite: go.fzj.de/juelichblog-rhoden
Text: Arndt Reuning | Bilder: Forschungszentrum Jülich/Sascha Kreklau | Video: Forschungszentrum Jülich