Künstliche Intelligenz auf dem Supercomputer
Chelsea Maria John braucht die Rechenpower von JUPITER, um Open-Source- Sprachmodelle zu entwickeln.
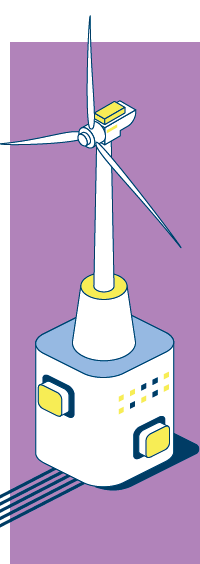
Weitaus alltäglicher sind die Anwendungen, mit denen sich Mathis Bode (JSC) beschäftigt: Er untersucht Strömungsphänomene von Flüssigkeiten und Gasen: „Da geht es zum Beispiel um die Aerodynamik von Autos und Flugzeugen, aber auch um die Vorgänge im Inneren von Turbinen und Motoren.“
Auch für viele Aspekte der Energiewende spielt die Simulation von Strömungen eine wichtige Rolle: Wie können Batteriepacks effizient gekühlt werden? Wie müssen Klimaanlagen ausgelegt werden, um sparsam ein Gebäude auf konstanter Temperatur zu halten? Wie müssen die Rotorblätter von Windkraftanlagen geformt werden, damit sie optimal die Energie aus der Luft ernten? Und auch in Hinblick auf den künftigen Energieträger Wasserstoff sieht Mathis Bode Anwendungspotenzial: „In einer Wasserstoffwirtschaft brauchen wir zeitnah Wasserstoffkraftwerke. Und für deren Entwicklung ist es nötig, die Prozesse in ihrem Inneren zu simulieren, etwa an den Turbinen. JUPITER erlaubt es uns erstmals, die realen, industriell relevanten Bedingungen auf einem Supercomputer abzubilden. Dabei liefert er die Simulationsresultate auch noch in viel kürzerer Zeit.“
Strömungsphänomene werden von den Navier-Stokes-Gleichungen beschrieben. Diese zu lösen, ist aber alles andere als alltäglich: Die Differentialgleichungen sind in der Regel so komplex, dass sie sich auch mit Supercomputern nur näherungsweise lösen lassen. Mathis Bode nutzt dazu unter anderem das Software-Paket nekRS, mit dem sich neben der reinen Strömungsmechanik weitere Vorgänge berücksichtigen lassen, wie etwa chemische Prozesse, die bei einer Verbrennung in einem Motor ablaufen. „Dazu muss das Programm die im Motor herrschenden extremen Bedingungen berücksichtigen, die die Strömung beeinflussen, wie hohe Temperaturen, hohe Drücke und starke Verwirbelung“, erklärt der Strömungsexperte. Zusätzlich kann nekRS alle relevanten Größen von Strömungsphänomenen gleichzeitig simulieren, ohne wichtige Informationen abzuschneiden: zum Beispiel sowohl die geometriegeführte Strömung als auch kleinste turbulente Wirbel. „All diese Daten bei der Strömung zu berücksichtigen, das stellt schon hohe Herausforderungen an eine Simulation und resultiert in einem enorm großen Rechen- und Memorybedarf.“
Mit JUPITER ändert sich das. „nekRS ist bereits dahin optimiert, auf Grafikkarten zu arbeiten, wie sie in JUPITERs Boostermodul zum Einsatz kommen. Durch die schiere Anzahl der Prozessoren ergibt sich ein enormer Zeitgewinn“, sagt Bode: „Was früher zwei Wochen gedauert hat, wird auf JUPITER nur noch einen Tag in Anspruch nehmen.“
Das Multitalent JUPITER lässt für eine Vielzahl von Forschungsfeldern gewaltige Fortschritte erwarten. Durch seine modulare Hardware-Architektur deckt er ein breites Spektrum an Anwendungen ab. Welche Erkenntnisse im Einzelnen auf die Fachleute in Jülich warten, lässt sich momentan noch nicht sagen. Das Exascale-Zeitalter in Europa hat gerade erst begonnen.

Text: Arndt Reuning