Aktuelle Ausgabe und alle Archivausgaben als PDF herunterladen
Wie Wälder atmen
Hitze, Dürre und Schädlinge lösen bei Pflanzen Stress aus. Die Zusammensetzung ihres „Atems“ ändert sich – das wirkt sich auch auf Luftqualität und Klima aus. Eva Pfannerstill ist den Veränderungen mit einer neuen Messmethode auf der Spur.

Der bunte Bildschirmschoner im Büro von Dr. Eva Pfannerstill zeigt den berühmten Felsbogen „Mesa Arch“ in Utah. Eine kleine Erinnerung an ihre drei Jahre als Postdoc in Berkeley (USA). Dort vermaß sie die Luft über Los Angeles, bevor sie im Oktober 2023 als Nachwuchsgruppenleiterin ans Jülicher Institute of Climate and Energy Systems (ICE-3) wechselte.
In Deutschland untersucht sie nun statt der Luft über Städten die Luft über Wäldern. Wichtigstes Werkzeug: Eine von ihr in Berkeley neu entwickelte Messmethode. Die Kombination aus einem hochmodernen Massenspektrometer und einem speziellen Rechenverfahren liefert eine Fülle an Messdaten von über 400 Substanzen in der Atmosphäre: neben typischen pflanzlichen Stoffen auch Fahrzeugemissionen, Lösungsmittel sowie Reinigungs- und Körperpflegeprodukte. „Das Besondere ist, dass wir die Stoffe nicht nur messen, sondern auch nachvollziehen können, aus welchen Quellen sie stammen“, freut sich Pfannerstill. Pro Sekunde lassen sich zehn Messwerte für die Stoffkonzentration erfassen und gleichzeitig mit derselben Messfrequenz der Wind in drei Dimensionen analysieren. „So können wir genau quantifizieren, welche Mengen der gemessenen Substanzen an welchem Ort emittiert werden – ob sie zum Beispiel seitlich eingeweht werden oder von der Landoberfläche stammen“, beschreibt die Forscherin.
Hohe Temperaturen verschärfen Luftverschmutzung
Ihre Methode hatte geholfen herauszufinden, warum die Feinstaub- und Ozonbelastung in Los Angeles bei steigender Temperatur zunimmt. „Eine der Ursachen sind die temperaturabhängigen Emissionen, die den „Atem“ der Metropolregion dominieren“, so die Expertin. Haupttreiber des Geschehens bei hohen Temperaturen sind Terpenoide aus Pflanzen, gefolgt von Verdunstungen aus Lösungsmitteln. Beide reagieren mit den Stickoxiden von Abgasen zu Ozon und Feinstaub (siehe Kasten).
Zeppelin-Flüge über deutschen Wäldern
Wie viele Terpenoide von deutschen Wäldern abgegeben werden, möchte Eva Pfannerstill bei kommenden Messkampagnen herausfinden – diesmal allerdings nicht vom Flugzeug aus, sondern vom Zeppelin-NT. Das hat Vor- und Nachteile: „Wir können deutlich tiefer, bis hinunter auf 100 Meter über dem Boden fliegen, aber wir haben weniger Platz in der Zeppelin-Kabine“, berichtet die Forscherin. Eine Herausforderung wird es sein, das Spektrometer an die beengten Verhältnisse anzupassen. „Hier profitieren wir von der Erfahrung aus bisherigen Jülicher Zeppelin-Kampagnen und dem Geschick der Jülicher Ingenieure“, betont Pfannerstill, die nicht die einzige Jülicherin ist, die bei den Messkampagnen mit dem Zeppelin Daten sammelt.
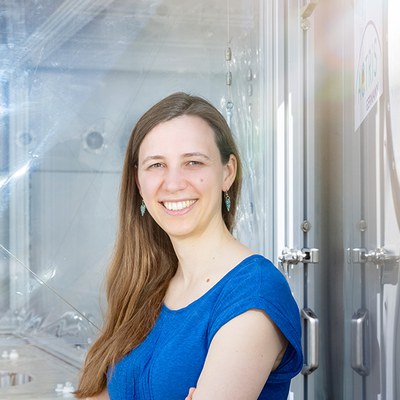
Mit unserer Methode können wir die Stoffe nicht nur messen, sondern auch nachvollziehen, aus welchen Quellen sie stammen.
Dr. Georgios Gkatzelis etwa erfasst mit dem gleichen Massenspektrometer organische Spurengase in der Luftzusammensetzung städtischer Regionen. Ein Gerät von Prof. Hendrik Fuchs und Dr. Anna Novelli misst, wie reaktiv die erfassten Gase sind. Und das Team von Prof. Uwe Rascher steuert ein Instrument bei, das die Fluoreszenz von Pflanzen erkennt. Diese zeigt an, ob die Pflanzen unter Stress stehen, noch bevor das menschliche Auge Veränderungen wahrnimmt.
Alle Faktoren berücksichtigen
Auch mit lokalen Forstbehörden werden die Forscher:innen zusammenarbeiten. „Sie können uns sagen, ob beispielsweise ein massiver Insektenbefall die Wälder plagt, die wir überfliegen. Pflanzen emittieren unterschiedliche Stoffe, je nachdem ob sie unter Dürre oder Insektenbefall leiden“, so Eva Pfannerstill.
Pflanzen geben gasförmige Duftstoffe in die Luft ab. Die Stressreaktionen, die Hitze, Dürre und Schädlinge bei Pflanzen auslösen, verändern unter anderem die Menge und Zusammensetzung der Duftstoffe. Dazu zählen flüchtige Kohlenwasserstoffe und Terpenoide wie etwa Isopren. Wie genau dieser Molekülmix bei verschiedenen Stressarten variiert, ist Gegenstand intensiver Forschung. Die Menge der Substanzen ist wichtig, weil einige mit Stickoxiden aus Autoabgasen oder anderen Emissionen zu Ozon reagieren und zur Bildung von Aerosolen beitragen. Aerosole können auf das Klima kühlend wirken, aber auch zu schädlichem Feinstaub werden.
Vorversuche startete die Chemikerin bereits in der Jülicher Atmosphärenkammer SAPHIR und der angeschlossenen Pflanzenkammer SAPHIR-PLUS. Junge Buchen und Eichen mussten dort bis zu 40 Grad Celsius und erhöhte Ozonwerte aushalten: „Das ist den Bäumchen nicht gut bekommen,“ resümiert Pfannerstill. Geplant ist zusätzlich ein kontrollierter Insektenbefall in der Kammer.
„Die Versuche an SAPHIR-PLUS zeigen uns, ob es ein bestimmtes ,Antwortmusterʻ der Bäume auf die unterschiedlichen Reize gibt. Nach diesen Signalen halten wir später während der Zeppelin-Kampagne Ausschau“, erklärt sie. Die Daten der Kampagne seien eine wichtige Ergänzung für bestehende Klimamodelle, da sich bisherige Berechnungen zur Stressantwort von Wäldern oft nur auf Labormessungen mit wenigen, kleinen Bäumen stützen.
„Das ist das Besondere an der Jülicher Forschung: Wir können Daten im kleinen Maßstab kontrolliert im Labor erheben und dann mit den Daten der großen Messkampagnen in der realen Welt vergleichen. Damit wollen wir Wege aufzeigen, wie sich die Luftqualität in den Städten und die Gesundheit der Wälder in einem sich wandelnden Erdsystem verbessern lässt“, fasst Pfannerstill zusammen.
Text: Brigitte Stahl-Busse / Bilder: Forschungszentrum Jülich: Sascha Kreklau


