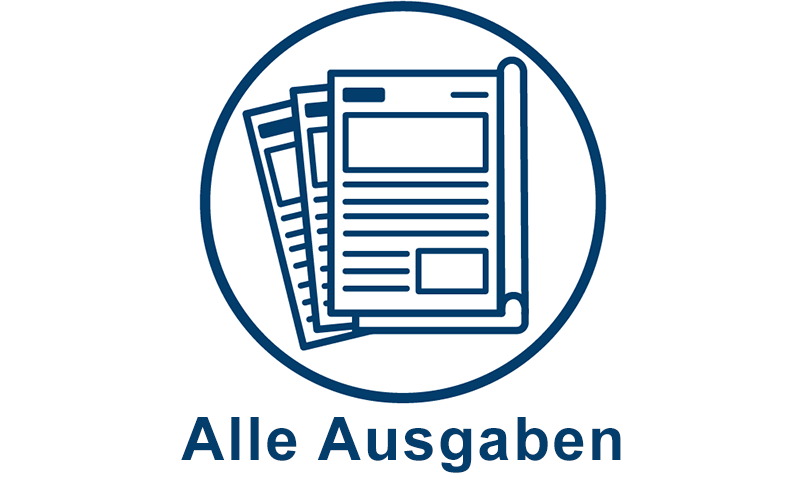Bakterien fressen Nylon

Bekannt wurde es durch Strumpfhosen: das synthetische Polyamid Nylon. Aufgrund seiner Langlebigkeit und hohen Zugfestigkeit wird das Material heute in vielen Produkten eingesetzt: von Unterwäsche und Sportbekleidung über Fallschirme und Angelschnüre bis hin zu Komponenten in der Automobilindustrie.
Es gibt aber ein Problem: Es fehlen geeignete Recyclingverfahren, weder chemisches noch klassisches mechanisches Recycling liefert brauchbare Ergebnisse. Die Recyclingquote von Polyamiden liegt bislang unter fünf Prozent. Viele Nylonabfälle landen entweder auf Deponien oder werden verbrannt, was giftige Substanzen freisetzen kann. Im Meer verloren gegangene oder zurückgelassene Fischernetze aus Nylon sind außerdem eine Gefahr für Meeresbewohner und Vögel.
Höherwertige Substanzen
Jülicher Biotechnolog:innen haben zusammen mit der Firma Novonesis eine Lösung gefunden. Sie haben im EU-Projekt Glaukos ein Bakterium entwickelt, das die Einzelbausteine verschiedener Nylonvarianten „frisst“ und in wertvolle Stoffe umwandeln kann. „Wir haben das vielseitige, aber harmlose Bodenbakterium Pseudomonas putida genetisch so weiterentwickelt, dass es dieses Gemisch aus Nylonbausteinen verstoffwechseln und sogar in höherwertige Substanzen wie Biopolyester umwandeln kann“, betont Prof. Nick Wierckx vom Institut für Bio- und Geowissenschaften (IBG-1).

Entscheidend für diesen Fortschritt war eine Kombination aus Gentechnik und Labor-Evolution, die es ermöglicht, Bakterien neue Fähigkeiten beizubringen. „Im Labor entwickelten einige Bakterien durch zufällige Mutationen die Fähigkeit, Nylonbausteine besser zu verwerten. Da sie dadurch schneller wachsen konnten als andere, setzten sie sich mit der Zeit durch – bis die Kultur schließlich fast nur noch aus diesen spezialisierten Zellen bestand“, berichtet Wierckx.
Die Forscher:innen konnten durch detaillierte Analysen der Genome die verantwortlichen Mutationen identifizieren und gezielt in Pseudomonas putida-Zellen einbauen. Im nächsten Schritt soll das Bakterium für den industriellen Einsatz fit gemacht werden und lernen, auch mit komplexeren Materialien wie beschichteten Textilien oder Fischernetzen umzugehen. Wir wünschen jetzt schon: guten Appetit!
Dieser Artikel ist Teil der effzett 1/2025. Text: Anna Tipping