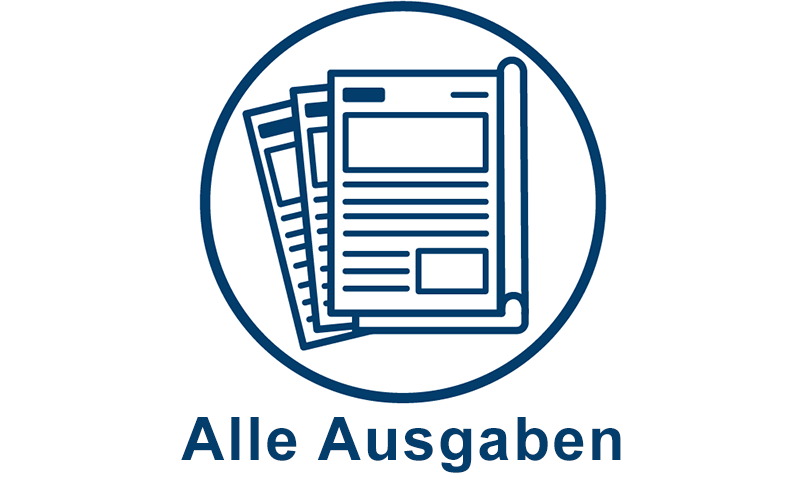Grüner Kraftstoff für Schiffe und Lastwagen
Es ist „Innovator des Jahres“ 2024: Das Projekt DeCarTrans möchte die Herstellung von klimafreundlichem E-Fuel aus Methanol verbessern.
Elektrofahrzeugen gehört die Zukunft, da sind sich Expert:innen sicher. „Doch es wird immer Nischen geben, in denen weiterhin flüssige Kraftstoffe auf Kohlenstoffbasis gebraucht werden – etwa im Schwerlast- und Schiffsverkehr“, sagt Dr. Joachim Pasel. Er leitet die Abteilung „Chemie der Kraftstoffsynthese“ am Institut für Elektrochemische Verfahrenstechnik (IET-4). Gemeinsam mit fünf Partnern untersucht sein Team im Projekt DeCarTrans die Herstellung von synthetischem Benzin aus Methanol. „Wir möchten zeigen, wie sich in nur einem Schritt aus Methanol ein erneuerbarer Kraftstoff im industriellen Maßstab herstellen lässt“, erläutert Pasel. Der bisherige Methanol-to-Gasoline-Prozess benötigt zwei chemische Schritte, was zeitaufwändig und teuer ist. Das Projekt macht Hoffnung, das sich dies ändern lässt. Das honoriert auch die deutschsprachige Wirtschaft: Sie hat DeCarTrans 2024 den Hauptpreis „Innovator des Jahres“ im Segment „Energie“ verliehen. Darüber hinaus wurde das Projekt mit dem Publikumspreis ausgezeichnet.

Kraftstoffe basieren heute in der Regel auf fossilen Rohstoffen wie Erdöl, bei deren Verbrennung CO2 freigesetzt wird. Eine klimaschonende Alternative wären nachhaltig erzeugte synthetische Kraftstoffe, gemeinhin auch als E-Fuels bezeichnet. Sie könnten herkömmliche Verbrennungsmotoren antreiben und über bestehende Infrastrukturen bereitgestellt werden. „Wir wollen demonstrieren, dass man ausgehend von grünem Methanol einen nachhaltigen Kraftstoff herstellen kann, der ähnliche Eigenschaften wie konventionelles Benzin hat“, so der Jülicher Forscher. Methanol lässt sich nachhaltig gewinnen, indem man etwa grünen Wasserstoff mit CO2 aus der Atmosphäre reagieren lässt.

Die Umsetzung des Methanols zu Treibstoff erfolgt im Pilotreaktor des Projektpartners CAC Engineering und in der Großversuchsanlage der TU Freiberg. Die Jülicher Forscher:innen entwickeln unterdessen eine virtuelle Nachbildung des Pilotreaktors: „Damit können wir das Geschehen am Computer simulieren und verschiedene Parameter wie Temperatur, Druck und Durchflussmenge testen“, sagt Pasel. Das reduziert die Kosten für die technische Umsetzung erheblich. Gespeist wird das rechnergestützte Modell mit experimentellen Daten aus eigenen Versuchen an einem kleinen Jülicher Testreaktor.
Das Projekt läuft noch bis Ende 2026. Und auch wenn das Laden einer E-Auto-Batterie stets energieeffizienter sein wird, als jeder Herstellungsprozess von synthetischem Benzin, ist Pasel optimistisch, dass „verbesserte E-Fuels künftig zur Senkung des CO2-Ausstoßes im Verkehrssektor vor allem bei bestehenden Flotten beitragen können.“
Dieser Artikel ist Teil der effzett 1/2025. Text: Janosch Deeg