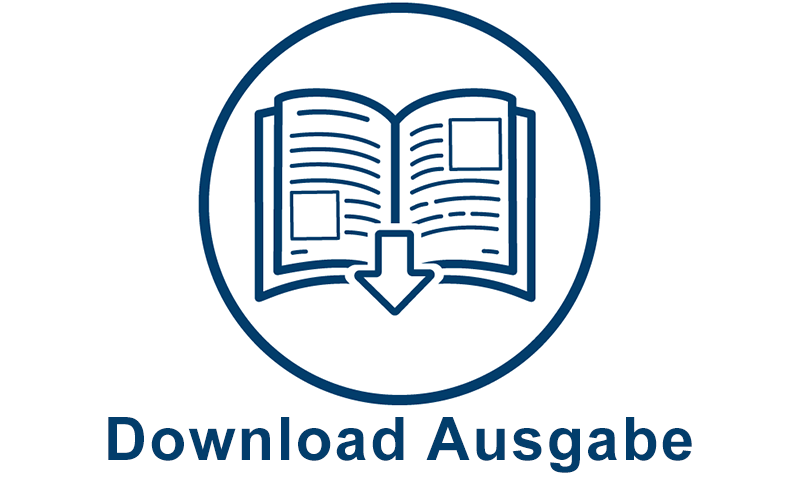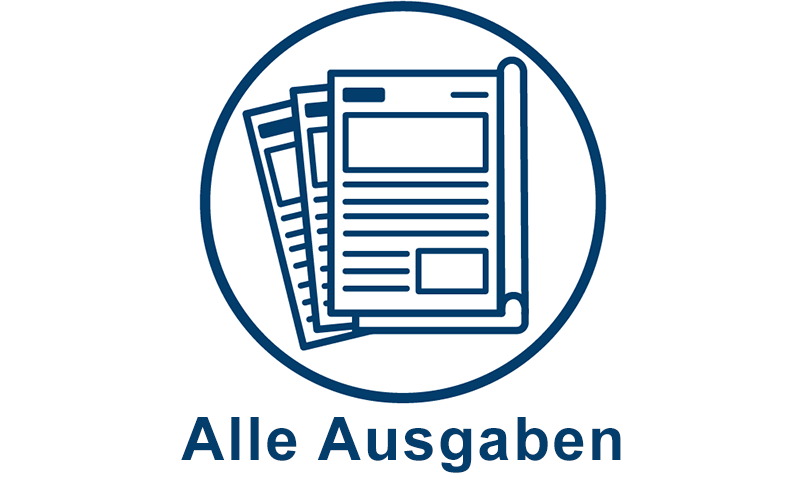Eine Möglichkeit, Qubits zu erzeugen, sind Halbleiter. Das Team um Prof. Hendrik Bluhm vom JARA-Institut für Quanteninformation nutzt zwei einzelne Elektronen, die in einem winzigen Plättchen in einer Art Falle gefangen sind. Sie bilden das Qubit. Das Plättchen besteht aus fünf halbleitenden Schichten, die sich in ihrer Zusammensetzung geringfügig unterscheiden, aber hauptsächlich die Elemente Gallium, Arsen und Aluminium enthalten. Auf der obersten Schicht haben die JARA-Wissenschaftler in der Jülicher Helmholtz Nano Facility eine winzige gitterartige Struktur aus Metall aufgebracht.
Aufgrund des speziellen Schichtaufbaus existiert im Plättchen eine Ebene, auf der sich Elektronen hin- und herbewegen, ohne die Ebene verlassen zu können. Den verbliebenen Freiraum der Elektronen in der Ebene können die Wissenschaftler einschränken, indem sie eine elektrische Spannung an dem Metallgitter anlegen. Denn die negative Ladung am Metall bildet eine unüberwindbare Hürde für die ebenfalls negativ geladenen Elektronen: Die Falle, die als Quantenpunkt bezeichnet wird, ist zugeschnappt.
Die halbleitenden Qubit-Plättchen der JARA-Forschenden sind besonders eng mit den Chips der heutigen Mikroelektronik verwandt. Weil die Industrie mit der Produktion von Mikrochips seit Jahrzehnten umfangreiche Erfahrungen gesammelt hat, könnten sich Halbleiter-Qubits für eine künftige Hochskalierung besonders eignen.
Es gibt aber noch weitere Ansätze, um Qubits zu erzeugen. Welche Technologie am Ende das Rennen macht, ist noch offen. In Jülich forschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch an supraleitenden Qubits. Dieser Ansatz gilt derzeit als führend, Google und IBM setzen zum Beispiel darauf. Dabei werden Qubits aus Strömen erzeugt, die widerstandslos in supraleitenden Schaltkreisen fließen. Bei diesen Qubits ist noch unklar, ob sich damit Computer mit Tausenden Qubits entwickeln lassen.
Während für die Halbleiter- und supraleitenden Qubits bereits funktionierende Systeme entwickelt wurden, steht die Forschung für Hybrid-Qubits noch ganz am Anfang. Die Idee: Auf einem gewöhnlichen Supraleiter wird ein sogenannter topologischer Isolator aufgetragen. Jülich, aber auch Microsoft, forschen daran. Topologische Isolatoren sind eine Materialklasse, die vereinfacht gesagt innen die Eigenschaften eines Isolators hat und außen die eines Leiters. Zumindest theoretisch ließe sich so ein Qubit erzeugen, das weniger störanfällig ist als etwa halb- oder supraleitende Qubits. Diese sind sehr empfindlich, schon bei kleinsten Störungen können Fehler auftreten.
Kandidaten für Hybrid-Qubits sind Majorana-Teilchen, die sich aber nur schwer erzeugen lassen, und sogenannte Gatemons, bei denen ein supraleitendes Qubit durch einen topologischen Isolator verändert wird.
Text: Frank Frick | Illustration: Andrzej Koston