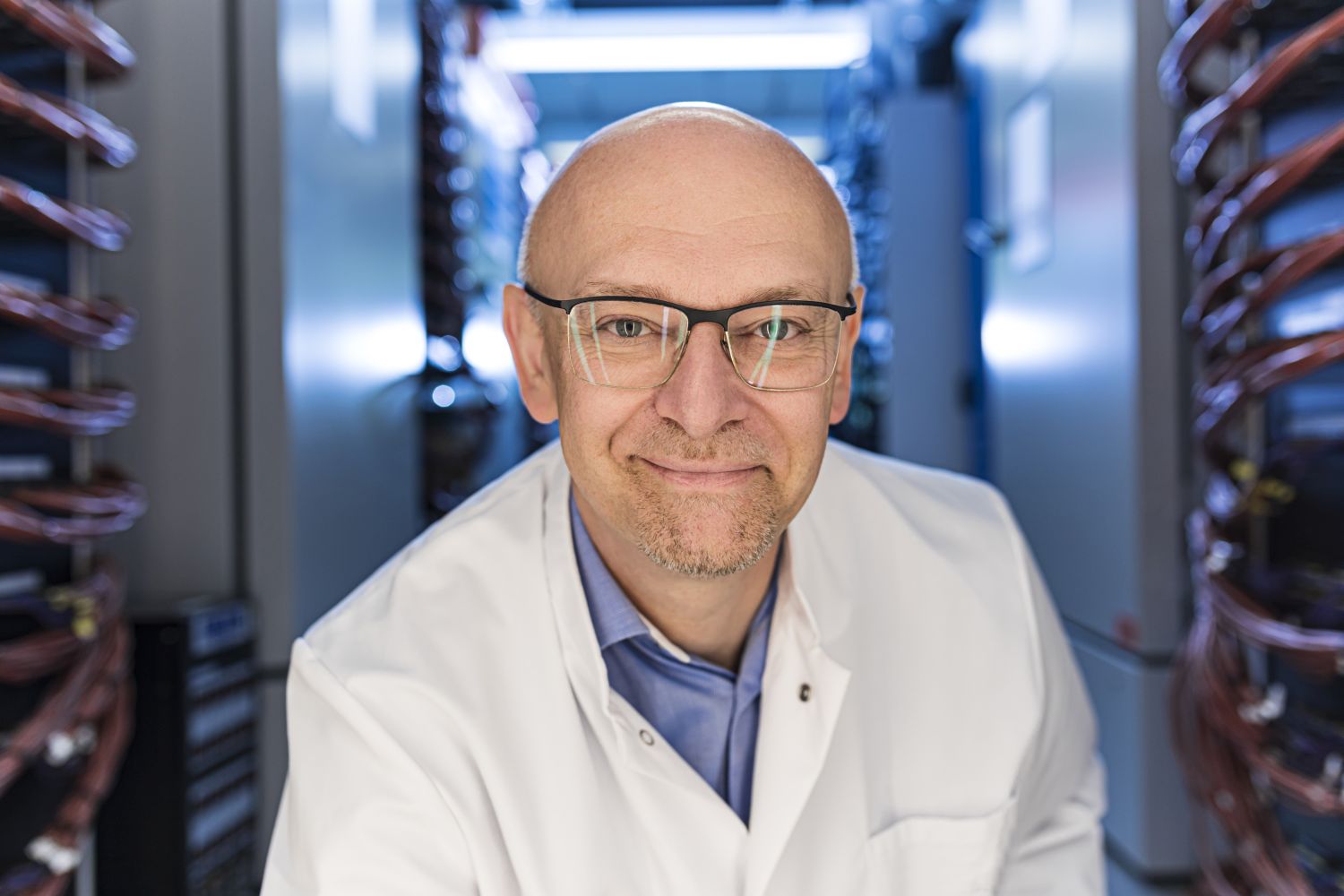Mehr Energiereserven anlegen
Mit jedem Prozent mehr Strom aus Wind und Sonnenkraft wird deutlicher: Es braucht mehr Speicher für die Energiewende – insbesondere unterschiedliche Speicher: nicht nur verschiedene Batterietypen, sondern auch Wasserstoff. Nur so lassen sich Schwankungen ausgleichen, Flauten überbrücken und das Netz stabil halten.
Spare in der Zeit, so hast du in der Not.“ Diese Weisheit hat der Mensch im Laufe seiner Geschichte schon so manches Mal beherzigt. So fingen zum Beispiel vor rund 11.000 Jahren unsere Vorfahren an, Getreide und Fleisch haltbar zu machen und Vorräte für den Winter sowie schlechte Zeiten anzulegen. Erste Vorratsspeicher waren Gefäße aus Keramik, mittlerweile nutzen wir unter anderem Getreidespeicher, Kühlgeräte und Konserven. Heute gilt es, die Weisheit auf ein weiteres wichtiges Gut anzuwenden: auf Energie. Auch hier geht es darum, Überschüsse zu speichern, um später Engpässe auszugleichen.
Mit solchen Engpässen müssen wir künftig rechnen, denn unsere Energieversorgung ändert sich. Bislang haben Kraftwerke immer so viel Energie erzeugt, dass Angebot und Nachfrage stets im Gleichgewicht gehalten wurden. Doch dazu haben wir vor allem fossile Brennstoffe verfeuert und so klimaschädliche Treibhausgase in die Atmosphäre geblasen. Um die Erderwärmung, wie im Pariser Klimavertrag vereinbart, unter 2 Grad Celsius zu halten, baut Deutschland die erneuerbaren Energien aus. Deren Anteil am Stromverbrauch soll bis 2030 auf 80 Prozent steigen. 2023 deckten die Erneuerbaren mit knapp 52 Prozent erstmals mehr als die Hälfte des Stromverbrauchs ab.
"Überschuss durch erneurbare Energien müssen wir speichern, um über die Nacht zu kommen, durch Wind- und Sonnenflauten, und um das Stromnetz kurzfristig stabil zu halten."
Dirk Witthaut
Doch Wind und Sonne sind launisch. Sie liefern Energie weder auf Knopfdruck noch konstant. „Wir müssen uns darauf einstellen, dass die Stromerzeugung künftig weniger beeinflussbar und planbar sein wird als heute. Aber wir werden mit Wind und Sonne immer wieder mehr Energie erzeugen, als tatsächlich zu dem Zeitpunkt benötigt wird. Diesen Überschuss müssen wir speichern, um über die Nacht zu kommen, durch Wind- und Sonnenflauten, und um das Stromnetz kurzfristig stabil zu halten. Dafür benötigen wir mehr und verschiedene Arten von Speichern“, sagt Prof. Dirk Witthaut vom Institute for Climate and Energy Systems (ICE-1).
Batterien im Fokus
Batteriespeicher gelten als technologisch und wirtschaftlich bestes Mittel, um regenerativ erzeugten Strom effizient und möglichst verlustfrei zu speichern. Bei der Speicherung und der anschließenden Rückverstromung erhält man 80 bis 90 Prozent der ursprünglichen Energie zurück. Schon heute gleichen Batteriespeicher Schwankungen im Stromnetz aus und sorgen so für eine gleichmäßige und stabile Stromversorgung. Dabei geht es sowohl um Schwankungen im Sekundenbereich als auch im Minuten- und Stundenbereich. „Diese Schwankungen gibt es auch ohne erneuerbare Energien, aber durch den Ausbau können sie künftig häufiger auftreten, da es weniger konventionelle Kraftwerke geben wird, die mit ihren Generatoren und Schwungrädern kurzfristig Energie bereitstellen können“, erklärt der Experte für Netzstabilität.
Titelgeschichte Stromspeicher
Allerdings benötigt Deutschland große Kapazitäten, um wie geplant bis 2045 treibhausgasneutral zu werden. Allein bei den elektrischen Speicherkapazitäten für die kurz- und mittelfristige Stromspeicherung – also für das Speichern für Sekunden bis hin zu mehreren Tagen – braucht es etwa 156 Gigawattstunden, so eine Analyse des Institute of Climate and Energy Systems (ICE-2). Davon entfallen rund 97 Gigawattstunden auf Batteriespeicher, den Rest sollen Pumpspeicherwerke bereitstellen.
Von diesen Zahlen sind wir derzeit noch weit entfernt. Ende 2023 lag die Kapazität der rund 1,1 Millionen stationären Batteriespeicher bei 11,6 Gigawattstunden. Zwar hat sich im Jahr 2023 die Anzahl der neu installierten Anlagen in Deutschland zum sechsten Mal in Folge verdoppelt, doch es kommen vorwiegend kleinere Heimspeicher mit maximal 20 Kilowattstunden neu ans Netz – also eher Speicher für private Photovoltaikanlagen. Großbatteriespeicher mit über 1.000 Kilowattstunden, wie sie etwa Firmen für die Sicherstellung der eigenen Energieversorgung und das Laden der firmeneigenen Elektrofahrzeuge nutzen, werden bislang nur selten installiert. Stromnetzbetreiber benötigen sogar Anlagen im Bereich von mehreren Megawattstunden. Damit lassen sich größere Schwankungen ausgleichen, etwa wenn ein Windpark bei starken Böen kurzzeitig deutlich mehr Strom erzeugt oder die Leistung eines großen Photovoltaikfelds sinkt, weil Wolken die Sonne verdunkeln.
Abhängigkeiten verringern
Derzeit marktbeherrschender Batterietyp in allen Größenordnungen ist der Lithium-Ionen-Akku – angefangen bei kleinen mobilen elektronischen Geräten wie Smartphones über Batterien von E-Autos bis hin zu stationären Stromspeichern. Lithium-Ionen-Akkus gelten als sehr effizient, verfügen über eine hohe Energiedichte und eine lange Lebensdauer. Für Prof. Martin Winter, Gründungsdirektor des Helmholtz-Instituts Münster (IMD-4, HI MS) und des MEET Batterieforschungszentrums der Universität Münster, ist dieser Akku-Typ das Maß aller Dinge. „Dabei hat diese eher junge Technologie noch lange nicht ihr Optimum erreicht“, betont der Batterieexperte.
Dennoch hält er es für falsch, nur auf diesen Typ zu setzen: „Manche Anforderungen an stationäre und mobile Speicher erfüllen möglicherweise andere Akku-Typen besser, die momentan technologisch noch nicht so ausgereift sind.“ Konkurrenz helfe außerdem, Preise niedrig zu halten. „Nach einem rasanten Preisanstieg 2021/22 ist der Preis für Lithium wieder deutlich gefallen. Das liegt daran, dass Natrium-Ionen-Akkus inzwischen für marktreif erklärt wurden und bereits in kleinen E-Auto- Prototypen eingesetzt werden“, verdeutlicht Winter.
"Manche Anforderungen an Speicher erfüllen möglicherweise Akku-Typen besser, die momentan technologisch noch nicht so ausgereift sind."
Martin Winter
Allerdings haben Natrium-Ionen-Akkus eine geringere Energiedichte. Um die gleiche Menge Energie zu speichern wie ein Lithium-Ionen- Akku, müssen sie schwerer und größer sein als dieser. Aber dafür haben sie einen anderen Pluspunkt: Natrium ist gut verfügbar, kostet wenig und ist vergleichsweise umweltfreundlich zu gewinnen. Das ist bei Lithium oft anders: Es gibt weniger Gebiete mit großen Vorkommen und die Gewinnung steht in vielen Fällen unter anderem wegen der damit verbundenen Umweltschäden in der Kritik. Das gilt ebenfalls für zwei weitere Bestandteile, die sowohl in Lithium- als auch Natrium-Ionen-Akkus verwendet werden: Nickel und Kobalt.
Forscher:innen des Institute of Energy Technologies (IET-1) suchen daher zum Beispiel nach neuen oder verbesserten Aktivmaterialien für die Kathode von Natrium-Ionen-Batterien, die möglichst ohne Kobalt und Nickel auskommen soll. Solche Arbeiten passen perfekt zum Dachkonzept Batterieforschung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Deutschland müsse seine Abhängigkeiten von teils politisch instabilen Weltregionen reduzieren und bei den Batterietechnologien künftig technologisch souverän agieren, heißt es dort. Um diese Ziele zu erfüllen, ist aus Sicht von Martin Winter anwendungsinspirierte Grundlagenforschung unabdingbar. Deshalb sieht er die aktuellen Kürzungen bei der Batterieforschung kritisch (siehe Interview).
Vielfalt ist gefragt
Sechs Kriterien sind laut Winter bei der Auswahl von Batterietypen entscheidend: Nachhaltigkeit, Kosten, Energiegehalt, Leistung, Lebensdauer und Sicherheit. „Je nachdem, welche Kriterien ein Batteriespeicher erfüllen soll, entscheidet sich, welchen Batterietyp wir verwenden sollten. Bei E-Autos stehen beispielsweise eher Volumen und Gewicht der Batterie im Vordergrund, bei stationären Batterien eher die Kosten“, fasst Winter zusammen. Am Helmholtz-Institut Münster und an den Instituten auf dem Jülicher Campus forschen Wissenschaftler:innen daher an verschiedenen Typen: neben den Lithium-und Natrium-Ionen-Batterien auch an Festkörperbatterien, Metall-Luft-Batterien und sogenannten Redox-Flow-Batterien (siehe Beispiele).
Doch allein neue Batteriespeicher werden für die Energiewende nicht reichen. „Akkus lohnen sich, um Schwankungen des Stromverbrauchs über den Tag hinweg auszugleichen oder als Reserve für Stunden oder vielleicht sogar wenige Tage, aber nicht für saisonale Speicher, wenn es um Wochen oder gar Monate geht. Hier muss man andere Lösungen anwenden“, macht Martin Winter klar.
Wasserstoffbasierte Lösungen für langfristige Speicherung
Das sieht auch Prof. Andreas Peschel, Direktor des Instituts für nachhaltige Wasserwirtschaft (INW-4), so: „Wir brauchen Batterien, aber sie sind nicht geeignet, eine tagelange Dunkelflaute zu überbrücken oder die heutigen Winterspeicher für Erdgas klimafreundlich zu ersetzen.“ Für eine langfristige Speicherung von Energie empfehlen sich vor allem Wasserstoffbasierte Lösungen. Dabei wird die elektrische Energie in chemische Energie umgewandelt, indem man mit ihr in Elektrolyseanlagen Wasserstoff aus Wasser erzeugt. In Brennstoffzellen kann die gespeicherte Energie wieder freigesetzt werden.
Wasserstoff lässt sich direkt als Energieträger einsetzen, aber auch als Reaktionspartner in Power-to-X-Technologien. Bei diesen wird der Strom aus erneuerbaren Quellen in Brenn- und Kraftstoffe oder Rohstoffe für die Industrie umgewandelt. Von besonderer Bedeutung sind dabei Syntheseprodukte wie etwa Methanol, Ammoniak und spezielle flüssige organische Verbindungen – sogenannte Liquid Organic Hydrogen Carrier, kurz LOHC. Zum einen lässt sich mit ihnen Energie bei Normaltemperatur und -druck bzw. nur geringfügig erhöhtem Druck speichern, zum anderen ist ihre Energiedichte pro Volumen deutlich höher als bei reinem Wasserstoff. „Solche Wasserstoffträger lassen sich ähnlich handhaben wie klassische fossile Brennstoffe und zum Beispiel gut per Schiff aus Übersee transportieren“, erläutert Peschel.
"Wasserstoffträger lassen sich ähnlich handhaben wie klassische fossile Brennstoffe und zum Beispiel gut per Schiff aus Übersee transportieren."
Andreas Peschel
Allerdings gibt es beim Wasserstoff noch vieles zu erforschen und entwickeln. Am INW arbeiten Peschel und seine Kolleg:innen vom INW gemeinsam mit Partnern an innovativen Technologien, die es möglich machen sollen, auf Wasserstoff als Energieträger umzusatteln. Dabei geht es darum, dass Wasserstoff leichter transportiert, gespeichert und verwendet werden kann. Ziel sind wasserstoffbasierte Lösungen, die mit der bestehenden Infrastruktur kompatibel sind. Die Forscher:innen untersuchen hierzu auch, wie Wasserstoff aus chemischen Wasserstoffspeichern zurückgewonnen werden und in verschiedene Anwendungen integriert werden kann – etwa als Treib- und Brennstoff oder in der Chemie.
Modellregion und Blaupause
Diese Forschung fließt in das Helmholtz-Cluster für nachhaltige und infrastrukturkompatible Wasserstoffwirtschaft HC-H2 ein. In dem Cluster wollen das INW und seine Partner das Rheinische Revier zu einer Wasserstoff-Modellregion entwickeln. Anfang März 2024 wurde das erste von mehreren geplanten Demonstrationsvorhaben in Betrieb genommen: ein Brennstoffzellensystem der Robert Bosch GmbH am Hermann-Josef-Krankenhaus in Erkelenz. In Kombination mit einer noch zu installierenden LOHC-Speichertechnologie soll die Anlage 20 Prozent des Strom- und Wärmebedarfs des Krankenhauses abdecken. „Das ist eine Größenordnung, mit der wir die Technologie für größere Bedarfe und andere Anwendungszwecke skalieren können, beispielsweise für Industrie und Gewerbe“, erläutert Peschel.
Auch andere Jülicher Institute beschäftigen sich mit Wasserstoff und Power-to-X-Technologien. Auf dem eigenen Campus erproben Jülicher Expert:innen sogar die Energiewende im kleinen Maßstab. Die Erkenntnisse des Projekts Living Lab Energy Campus (LLEC) sollen als Blaupause für Wohn- und Industriegebiete genutzt werden. Mithilfe unterschiedlicher Speichertechnologien wie etwa Großbatterien und Wasserstoff werden zum Beispiel Strom, Wärme und chemische Energie gekoppelt. Auch der Mobilitätssektor ist eingebunden, indem Batterien von E-Autos als Zwischenspeicher genutzt werden. Falls es künftig gelingt, dass viele Menschen ihre E-Autos als Energiespeicher für die öffentlichen Netze zur Verfügung stellen, müssten vermutlich deutlich weniger neue stationäre Batteriespeicher installiert werden. Jülicher Forscher:innen vom ICE-2 schätzen, dass E-Autos knapp zwei Drittel der bis 2045 benötigten 97 GWh Speicherkapazität bei Batterien abdecken könnten. Damit das möglich wird, müssen allerdings erst regulatorische Hürden für die Einspeisung von Strom aus der Fahrzeugbatterie ins Netz abgebaut und attraktive Geschäftsmodelle entwickelt werden. Hier sind noch viele Fragen offen.
Prinzipiell ist aber für die Jülicher Expert:innen klar: Wir brauchen verschiedene Speichertechnologien und mehr Speicher für ein klimaneutrales Energiesystem. Dann bleibt das Stromnetz stabil und niemand muss fürchten, bei einer Flaute im Dunkeln zu sitzen. Und wer weiß, vielleicht wird der Stromvorrat im Keller für künftige Generationen genauso üblich, wie für uns heute die mit Erbsen, Pizza und Aufbackbrötchen gefüllte Gefriertruhe.
Text: Frank Frick/Christian Hohlfeld | Fotos: Forschungszentrum Jülich/Ralf-Uwe-Limbach, Forschungszentrum Jülich/Sascha Kreklau; Illustrationen: Jens Neubert
Kontakt
- Institut für nachhaltige Wasserstoffwirtschaft (INW)
- Institute of Energy Materials and Devices (IMD)
- Helmholtz-Institut Münster: Ionenleiter für Energiespeicher (IMD-4 / HI MS)
- Institute of Climate and Energy Systems (ICE)
- Energiesystemtechnik (ICE-1)