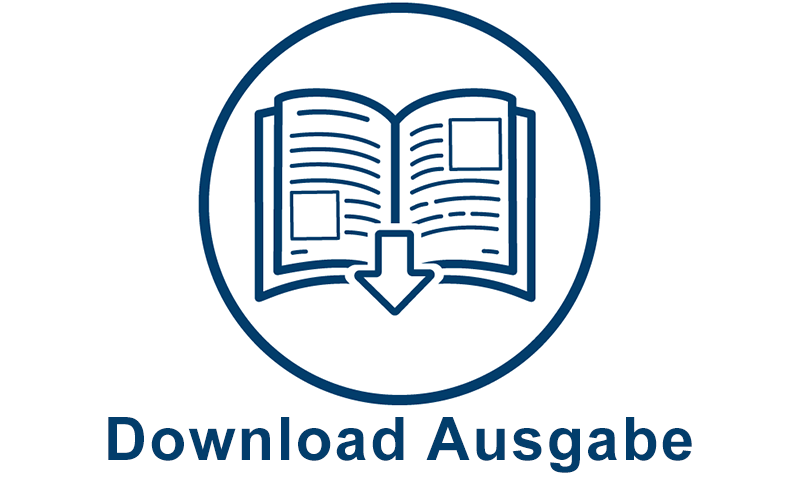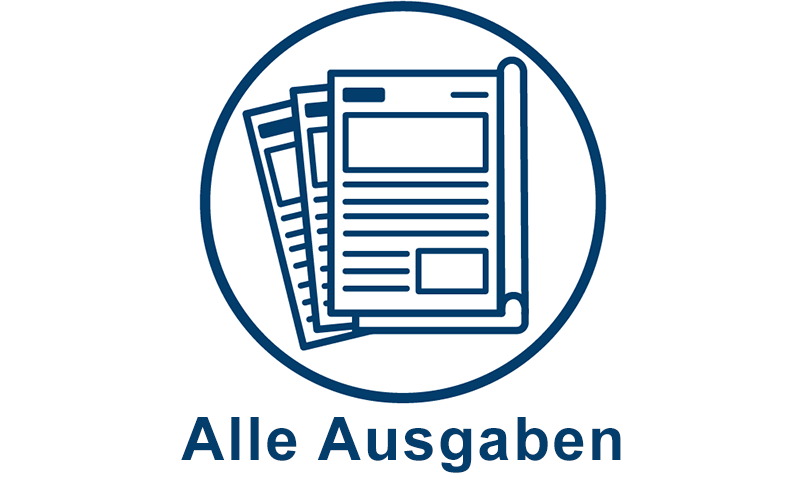„Stresst mich nicht!“

Wie gut Jugendliche mit psychischen Problemen umgehen können, hängt unter anderem mit der Struktur ihres Gehirns zusammen – genau genommen mit einer gut ausgeprägten Schutzschicht für Nervenzellen, der Myelinstruktur.
Mobbing in der Schule, ständige Konflikte zu Hause, traumatische Erfahrungen: Während einige Jugendliche solche Belastungen gut meistern können, bereiten sie anderen enorme Probleme. Das kann sogar zu psychischen Krankheiten führen. Woran liegt dieser Unterschied?

Bei besserer Myelinisierung steckt man Stress besser weg.
Eine Vermutung: Es könnte Zusammenhänge zwischen der Hirnstruktur und der Resilienz von Teenagern geben – also ihrer Fähigkeit, mit belastenden Situationen umzugehen. Sofie Valk und Meike Hettwer vom Jülicher Institut für Neurowissenschaften und Medizin (INM-7) und dem Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig sind gemeinsam dieser Frage nachgegangen.
„Uns hat vor allem interessiert, wie sich Änderungen im Stresslevel oder traumatische Erfahrungen – wie etwa der Tod der Großmutter – auf die mentale Gesundheit von Jugendlichen beziehungsweise deren Anpassungsfähigkeit auswirken. Und wie das wiederum mit der Gehirnstruktur der Jugendlichen zusammenhängt“, erläutert Valk.
Der Hintergrund: Im jugendlichen Alter wird das Gehirn stark umgebaut, insbesondere die kognitiven Netzwerke werden neu strukturiert und ausgebildet. Das Denken wird komplexer, die Fähigkeit, sich in das soziale Umfeld einzufügen, verbessert sich. Doch gehen diese Veränderungen meist auch mit einer höheren Verletzlichkeit einher. So können Jugendliche auf negative Umwelteinflüsse instabiler und anfälliger reagieren.
Immer mehr Jugendliche betroffen
Depressionen, Essstörungen, Angstzustände – solche psychischen Erkrankungen treten oft erstmals in der Pubertät und im jungen Erwachsenenalter auf. Die Zahlen steigen bedenklich: 2022 ging fast jeder fünfte Krankenhausaufenthalt (19 Prozent) der 10- bis 17-Jährigen auf psychische Erkrankungen zurück, im Jahr 2012 waren es nur 13 Prozent. Am häufigsten wurden die Jugendlichen wegen Depressionen behandelt.
Für die Untersuchungen nutzten die Wissenschaftlerinnen einen öffentlich zugänglichen Datensatz aus Cambridge und London. Dieser umfasst zum einen die Ergebnisse einer zweimaligen Befragung von 14- bis 24-Jährigen hinsichtlich ihrer Situation daheim, ihrem Freundeskreis sowie bisher erlebten Traumata – durchgeführt im Abstand von ein bis zwei Jahren. Zum anderen enthalten die Daten je Proband zwei Magnetresonanztomographie-Scans, kurz MRT-Scans, vom Gehirn, die jeweils zur Zeit der Befragungen erstellt wurden.
Hirnscans analysiert
„Während einige Jugendliche trotz schwieriger Umstände angaben, sich gut zu fühlen, sprachen andere von großer Belastung durch äußere Faktoren“, berichtet Valk. Um herauszufinden, wie die mentale Gesundheit der Testpersonen mit dem Gehirn zusammenhängt, haben die Forscherinnen einen Teil des Datensatzes genauer analysiert. Und zwar die MRT-Aufnahmen von 141 Proband:innen, die mit der Zeit besser oder schlechter mit psychosozialem Stress umgehen konnten – also mit dem Alter resilienter oder anfälliger wurden.
Konkret haben sich die Forscherinnen einen bestimmten Teil des Gehirns näher angeschaut: die Myelinstruktur. Myelin besteht aus Proteinen und Fetten und legt sich als schützende Schicht um die Ausläufer der Nervenzellen. Es stabilisiert und isoliert die Netzwerkverbindungen – und sorgt somit dafür, dass die Nervensignale ungehindert, schnell und effizient von Zelle zu Zelle wandern können.


In der Pubertät befindet sich diese Myelinstruktur noch im Aufbau. Die Forscherinnen entdeckten einen interessanten Zusammenhang zwischen dieser Struktur und der Fähigkeit, sich an schwierige Umstände anzupassen. Bei Jugendlichen, die im Laufe der Zeit besser mit schwierigen Umständen umgehen konnten, hatte sich die Myelinstruktur in bestimmten Hirnregionen schneller aufgebaut. „Resilienz und Myelinstruktur stehen offenbar in einem Zusammenhang“, sagt Valk. „Wie resilient und anpassungsfähig Jugendliche gegenüber psychosozialem Stress sind, scheint einen direkten Einfluss auf die Gehirnentwicklung zu haben. Das gilt auch umgekehrt: Bei besserer Myelinisierung steckt man Stress besser weg.“
Neben der Myelinstruktur haben die Wissenschaftlerinnen mithilfe der MRT-Daten auch die funktionellen Netzwerke im Gehirn untersucht – genauer gesagt, welche Hirnstrukturen und -regionen eng miteinander verbunden waren, als die Probanden in Ruhe in der MRT-Röhre lagen. Die Ergebnisse: Jugendliche, die mit der Zeit resilienter wurden, zeigten nicht nur eine stärkere regionale Myelinisierung. Auch die kognitiven Netzwerke in den betreffenden Bereichen blieben stabiler. Das heißt, die Verbindungen zwischen den Gehirnregionen veränderten sich nur wenig.
Dagegen waren die Netzwerke bei Jugendlichen, die mit der Zeit anfälliger für Stress wurden und eine schwächere Myelinisierung zeigten, weniger stabil und veränderten sich mehr. Anders ausgedrückt: Dies könnte bedeuten, dass ihre Gehirne anfälliger für negative äußere Einflüsse und die Jugendlichen nicht so belastbar waren.
Noch offene Fragen
Inwieweit die Ergebnisse helfen, die Resilienz von Jugendlichen zu stärken, muss noch untersucht werden. „Für uns ist es eine wichtige Erkenntnis, dass sich der unterschiedliche Umgang mit belastenden Situationen bei Jugendlichen auch in der Entwicklung des Gehirns widerspiegelt“, sagt Valk. „Möglicherweise lassen sich Myelinisierung und Stabilisierung der Netzwerke im Gehirn durch psychosoziale Hilfsangebote wie Gesprächstherapien oder Sportangebote verbessern. Auch das muss geprüft werden.“
Dieser Artikel ist Teil der effzett 2/2024. Text: Janine van Ackeren
Keine effzett mehr verpassen