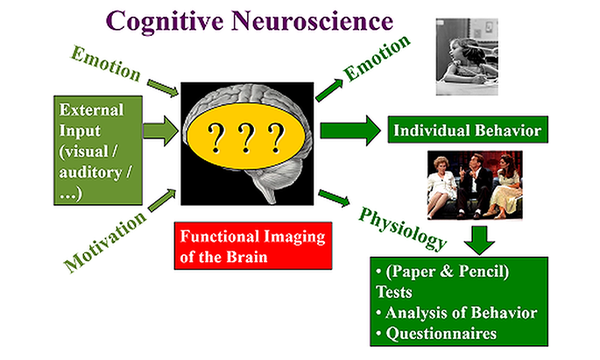Mit der Entdeckung der beiden Sprachzentren für die Lautartikulation und das Sprachverstehen durch den französischen Anatom Paul Broca 1861 und den deutschen Neurologen Carl Wernicke 1874 begann die detaillierte Kartierung des Gehirns. Heute ist bekannt, welche Gehirnareale uns sprechen, sehen, hören, bewegen, verstehen und fühlen lassen. Und dennoch: Im Detail ist jedes Gehirn anders.
"Wir interessieren uns für die individuellen Unterschiede in der strukturellen und funktionellen Organisation des Gehirns", sagt Privatdozentin Susanne Weis, Leiterin der Gruppe "Variabilität des Gehirns" am Institut für Neurowissenschaften und Medizin (INM-7). Ein sehr grundlegender Unterschied zwischen Individuen ist ihr Geschlecht.* Anatomisch ist es in den meisten Fällen eindeutig männlich oder weiblich. Susanne Weis und ihr Team wollten wissen, ob sich diese Unterschiede auch im Gehirn zeigen und wenn ja, wo.
Jeder Mensch ein bunter Mix
Entgegen früheren psychologischen Tests, in welchen Frauen und Männer wettbewerbsartig in den Disziplinen räumliches Denken, Sprachverstehen oder Feinmotorik gegeneinander antraten, taten die Proband:innen in der Jülicher Studie: nichts. "Wir wollten sehen, welche Unterschiede es im Ruhezustand gibt, losgelöst von irgendwelchen Aufgaben", betont Weis. Hierzu ließ das Team eine Künstliche Intelligenz über 1.600 Kernspinaufnahmen aus eigenen und mehreren großen Gehirnstudien durchforsten.
Die KI war darauf trainiert, Muster in 500 funktionellen Regionen des Gehirns zu erkennen, sie als typisch männlich oder typisch weiblich einzustufen und dann zu entscheiden: Das ist ein Mann, das ist eine Frau. Die Trefferquote: rund 70 Prozent. "Wieso aber nicht 100 Prozent?", fragt Weis. Bei genauer Betrachtung der Daten stellte sich heraus: Jede einzelne der 500 Regionen kann bei jedem Menschen eher in die Kategorie männlich oder weiblich fallen – oder sogar in beide Bereiche. So ergibt sich für jede Person ein bunter Mix aus männlichen, weiblichen und uneindeutigen Arealen. "Und das ist bei der Mehrheit der getesteten Gehirne der Fall", unterstreicht Weis. Rein weibliche oder rein männliche Gehirne gibt es also kaum, sondern fast ausschließlich Gehirne mit mehr weiblichen, mehr männlichen oder überwiegend uneindeutigen Regionen.
Im Alter ähnlicher
Die Trefferquote der KI lag in manchen Hirnregionen höher als in anderen: In den Regionen für Emotionen, soziales Verständnis, räumliches Gedächtnis und Sprache entdeckte die KI deutliche Unterschiede zwischen Männer und Frauen. Also doch typisch Mann, typisch Frau? "Stereotypen kommen nicht von ungefähr", gibt Susanne Weis zu bedenken, „aber die Studien zeigen, es gibt nicht das typische männliche oder das typisch weibliche Gehirn, sondern wir alle liegen irgendwo dazwischen.“ Und es sei auch noch nicht abschließend geklärt, woher die Unterschiede in den Gehirnregionen kommen: ob sie etwa angeboren, anerzogen oder durch die Umwelt, den Lebensstil beziehungsweise die Erfahrungen geformt sind, so Weis.
Ein für die Forscher:innen völlig überraschendes Ergebnis spielt in diese Frage hinein: Die KI identifizierte im Gehirn junger Menschen sehr viel mehr Regionen, die sich als typisch männlich oder typisch weiblich einstufen ließen. Gleichen sich die Geschlechter im Alter immer also immer mehr an? Intuitiv hatten die Forscher:innen vermutet, dass sich im Laufe des Lebens die Unterschiede zwischen Männern und Frauen verstärken, durch soziale Prägung zum Beispiel. Eine mögliche Interpretation: "Jedes Gehirn wird mit dem Alter etwas weniger leistungsfähig. Um das zu kompensieren, muss es andere Möglichkeiten finden, mit bestimmten Aufgaben umzugehen. Offenbar gibt im Laufe der Zeit zunehmend weniger unterschiedliche Möglichkeiten, sodass wir uns immer ähnlicher werden", vermutet die Neurowissenschaftlerin. Diese Daten wollen sich die Forscher:innen aber noch einmal genauer anschauen.
"Die Überlappung der männlichen und weiblichen Eigenschaften des Gehirns ist enorm hoch – jedes Gehirn ist ein einzigartiges Mosaik aus beiden."
Susanne Weis
Was die Interpretation der Daten zudem verkompliziert: "Die Funktion und Organisation des Gehirns verschiebt sich immer wieder – mitunter sogar innerhalb eines Monats", betont Weis. So arbeiten die Gehirnhälften von Frauen je nach Phase ihres Menstruationszyklus mal mehr und mal weniger zusammen. Weis und ihre Kolleg:innen plädieren daher dafür, dass bei Gehirnstudien immer auch der Hormonstatus der Proband:innen erhoben wird, um dessen Effekte besser zu verstehen.
Individueller und toleranter
Da offensichtlich ganz viel vom anderen Geschlecht in einem steckt, sieht Susanne Weis insbesondere die gegenseitige Toleranz gestärkt: "Die Überlappung der männlichen und weiblichen Eigenschaften des Gehirns ist enorm hoch – jedes Gehirn ist ein einzigartiges Mosaik aus beiden." Sie warnt daher davor, in die Falle der selektiven Wahrnehmung zu tappen: "Vielleicht kategorisiert man einen schlecht einparkenden Mann als Ausnahme und vergisst den Vorfall ganz rasch. Wohingegen die gut zuhörende Frau in die schon vorhandene Schublade der weiblichen Empathie gesteckt wird. Das Geschlecht ist zwar ein Aspekt, der unser Gehirn beeinflusst", sagt Weis, "aber es ist nur ein Faktor. Ganz viele weitere Komponenten machen uns zu der Person, die wir sind: zum einzigartigen und typischen 'Ich'."
* In den meisten bisher durchgeführten Gehirnstudien wird nicht danach gefragt, welchem Geschlecht sich jemand zugehörig fühlt. Es wird nur das biologische Geschlecht erfasst. Im INM-7 wird aber auch zu Fragen des sozialen Geschlechts geforscht, etwa zu Transgender. Soziales Geschlecht bezieht sich auf die individuelle Identität und die soziale Rolle eines Menschen in Bezug auf das Geschlecht.
Text: Brigitte Stahl-Busse | Foto oben: Studio Bachmann - stock.adobe.com
Ansprechperson
- Institut für Neurowissenschaften und Medizin (INM)
- Gehirn und Verhalten (INM-7)