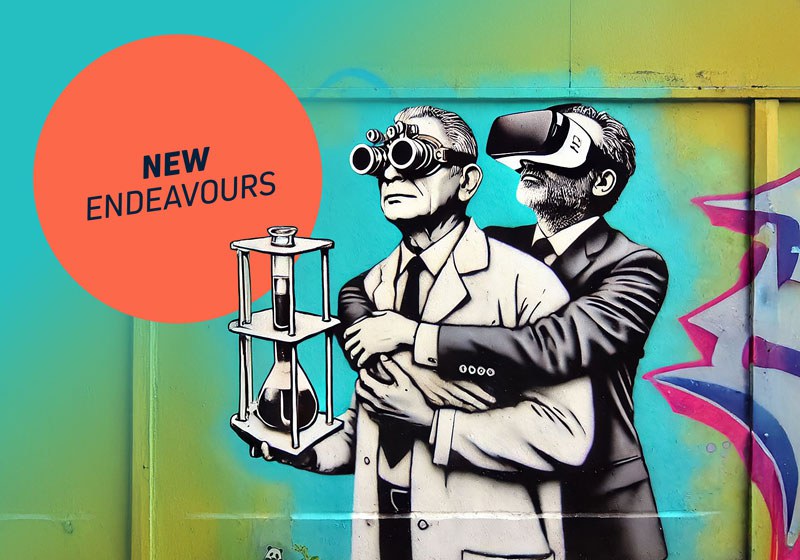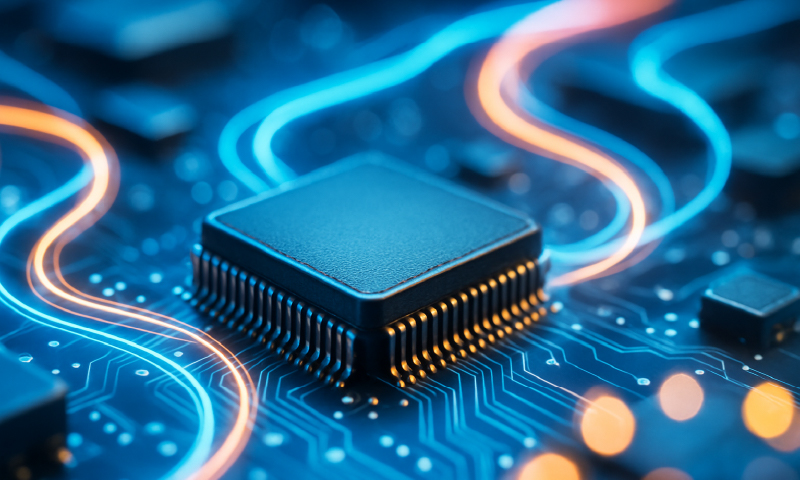Der PET-Pionier
Pioniere – Lebensleistung von Prof. Langen
Prof. Karl-Josef Langen hat die Hirntumordiagnostik vorangebracht. Seine Arbeit ist wegweisend dafür, wie aus Grundlagenforschung medizinische Innovation wird. Im Interview spricht er über Erfolge, Hürden und aktuelle Herausforderungen.
Mai 2025
Bildgebende Verfahren sind ein etabliertes Instrument in der Medizin. Mit ihnen lassen sich etwa Strukturen im Körper erfassen. Bekannte Beispiele sind Ultraschallbilder oder Röntgenbilder. Karl-Josef Langen beschäftigt sich mit einem speziellen Bereich: mit bildgebenden Verfahren in der Nuklearmedizin, insbesondere zur Diagnose von Hirntumoren. Bei solchen Verfahren werden leicht radioaktive Substanzen, sogenannte Tracer, in den Körper eingebracht.
Seit Mitte der 1980er Jahre hat Langen mit seinem Team in enger Zusammenarbeit mit Kliniken innovative Verfahren entwickelt, die heute Tausenden Menschen zugutekommen. Nach Jahrzehnten am Forschungszentrum Jülich geht er nun in den Ruhestand. Er bleibt der Wissenschaft aber erhalten: an der Uniklinik RWTH Aachen bringt er weiterhin seine Expertise ein.
Prof. Langen, wie sind Sie zur medizinischen Bildgebung gekommen?
Im Medizinstudium lernte ich im Wahlfach Radiologie bildgebende Verfahren wie Computertomographie und Ultraschall kennen. Das waren damals in den 1980er Jahren noch relativ neue Technologien mit großem Potenzial. Am Forschungszentrum Jülich, an dem ich 1985 anfing, spezialisierte ich mich auf die Nuklearmedizin. Der entscheidende Impuls kam 1988, als ich auf einem Symposium von neuen Anwendungen der Positronenemissionstomographie – kurz PET – hörte. Es ging um den Einsatz radioaktiv markierter Aminosäuren in der Hirntumordiagnostik. Das enorme Potenzial dieser Methode war für mich sofort erkennbar.

»Bis heute haben wir über 11.000 Patientinnen und Patienten untersucht, jedes Jahr kommen etwa 700 hinzu.«
Prof. Karl-Josef Langen
Gruppenleiter am Institut für Neurowissenschaften und Medizin: Physik
der Medizinischen Bildgebung (INM-4)
Was macht diese Methode aus?
Mithilfe der radioaktiv markierten Substanzen, den Tracern, können wir bei der Hirntumordiagnostik mit PET Stoffwechselprozesse sichtbar machen. Da sich der Stoffwechsel von gesundem Gewebe und von Krebsgewebe unterscheidet, liefern die Aufnahmen Hinweise auf Tumore.
Effzett: Untersuchungsmethode PET erklärt
Auf welchen Meilenstein blicken Sie besonders stolz zurück?
Ein wichtiger Meilenstein war die Entwicklung des Tracers FET (Fluorethyl-Tyrosin) Mitte der 1990er Jahre im Forschungszentrum. FET hatte entscheidende Vorteile im Vergleich zu damaligen Tracern, etwa mehr Stabilität. 2005 konnten wir nachweisen, dass sich die Ausdehnung von Hirntumoren mit der FET PET besser darstellen lässt als mit einem anderen wichtigen bildgebenden Verfahren, der Magnetresonanztomographie (MRT). Die FET PET wird heute weltweit eingesetzt und ermöglicht zum Beispiel, präziser zwischen Narbengewebe und neuem Tumorwachstum nach einer Therapie zu unterscheiden.
Hirntumore schnell und präzise erkennen: PET und KI
Welche Rolle spielt die Zusammenarbeit mit Kliniken für Ihre Forschung?
Eine Essenzielle. Neue diagnostische Verfahren setzen sich nur durch, wenn Ärzte einen klaren Nutzen für die Patienten erkennen können. Bis heute haben wir über 11.000 Patienten untersucht, jedes Jahr kommen etwa 700 hinzu. An der Uniklinik RWTH Aachen sind wir Anlaufpunkt für fast ein Drittel der Patienten in Deutschland. Durch den direkten Kontakt mit ihnen erleben wir nicht nur den praktischen Nutzen unserer Forschung hautnah, sondern erhalten auch Hinweise, um die Verfahren gezielt weiterzuentwickeln.
Rückblick ins Jahr 2005
Prof. Langen am PET-Scanner

Was sind die größten Hürden bei der Übertragung wissenschaftlicher Erkenntnisse in die klinische Praxis?
Das sind vor allem die regulatorischen Anforderungen und der bürokratische Aufwand. Die klinische Prüfung neuer Radiopharmaka erfordert oft jahrelange Studien, was den Transfer neuer Methoden verzögert. Die hohen Kosten für PET Untersuchungen mit neuen Radiopharmaka stellen zudem viele Kliniken vor finanzielle Herausforderungen. Über unsere Infrastruktur in Jülich konnten wir die Untersuchungen in der Anfangsphase kostenlos anbieten und so die Akzeptanz fördern.
Was sind die aktuellen Forschungsfragen in der medizinischen Bildgebung?
Die Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz eröffnen völlig neue Möglichkeiten. KI kann helfen, PET und MRT Bilder noch besser zu analysieren und die komplexen Auswertungsprozesse zu automatisieren. Unsere Arbeitsgruppe forscht bereits intensiv in diesem Bereich. Auch die Prüfung neuer Tracer bleibt ein spannendes Forschungsfeld.
Mehr über die nuklearmedizinische Hirnturmodiagnostik am FZ Jülich erfahren
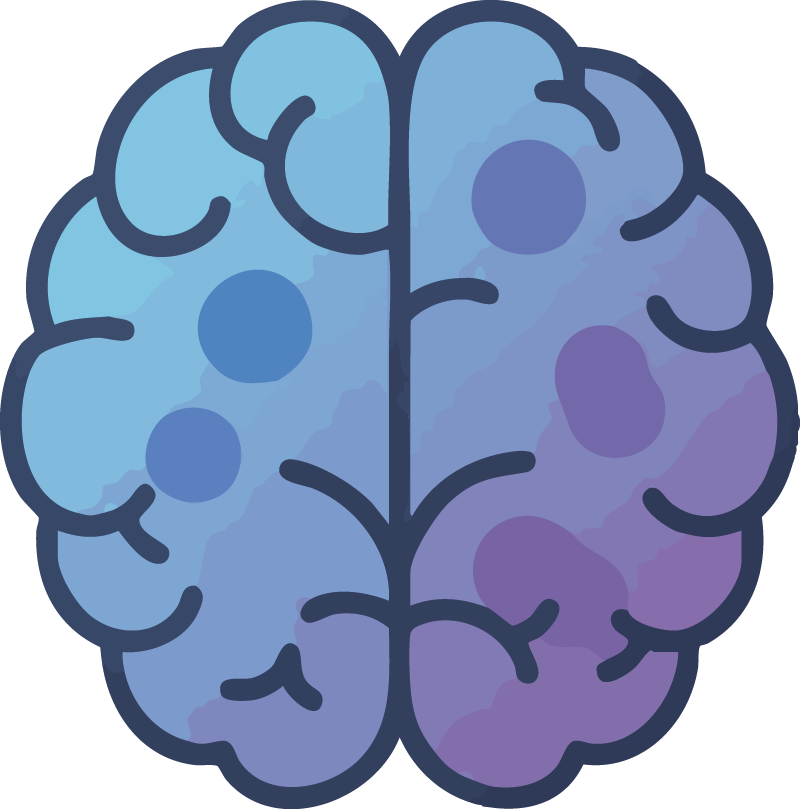
Mehr sehen, besser handeln
Das FET PET ist ein bildgebendes Verfahren der Nuklearmedizin, das den Aminosäurestoffwechsel im Gehirn sichtbar macht. Es kann Hirntumore oft genauer darstellen als eine herkömmliche MRT und hilft dabei, auch Metastasen zu entdecken, die aus anderen Körperregionen ins Gehirn gelangt sind. So trägt FET PET dazu bei, Diagnosen gezielter zu stellen und Behandlungen besser zu planen.
Bildnachweis: Karl-Josef Langen/ Forschungszentrum Jülich
Tiefer Blicken: Die aktuelle Ausgabe
Gemeinsam geht mehr – besonders, wenn Forschung, Industrie und Gesellschaft ihre Perspektiven verbinden. Dann entstehen Lösungen, die größer sind als die Summe ihrer Teile.
Im Endeavours-Magazin zeigen wir, wie Co-Creation gelingt: mit echten Geschichten von Kooperation, Pioniergeist und Transfer. Für eine Zukunft, die wir gemeinsam gestalten können.